![[Machu Picchu]](machupicchu.jpg)
PERU - PATTAYA - POSEMUCKEL
VON HÖHENLUFT UND LIEBE
"El Camino hacia la Libertad"
![[Machu Picchu]](machupicchu.jpg)
EIN KAPITEL AUS DIKIGOROS' WEBSEITE
REISEN DURCH DIE VERGANGENHEIT
GESCHICHTEN AUS DER GESCHICHTE
Irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, irgendwo in Perú (so wird es richtig geschrieben, liebe Leser; ohne Akzent - also als "Peru" - müßte man es im Spanischen auf der ersten Silbe betonen), sitzend drei höher-semestrige - böse Zungen würden sagen: verbummelte - Studenten in einem mittelprächtigen Gasthaus und blasen Trübsal. Draußen regnet es, schon seit Tagen. Sintflutartig. Die Straßen stehen unter Wasser, Eisenbahnen gibt es noch nicht, geschweige denn Flugzeuge. Nicht mal die Maulesel wollen noch einen Schritt weiter gehen, erst recht nicht die zerlumpten, barfüßigen Soldaten. Wo sind sie eigentlich genau? Dikigoros weiß es nicht, aber er tippt auf Cajamarca, am Schnittpunkt der beiden alten Inka-Straßen. (Andere gibt es bis heute nicht; man hat zwar eine davon mehr schlecht als recht ausgebaut und sie großkotzig, pardon großzügig zum "Pan American Highway" ernannt - aber jeder, der sie mal abgefahren ist, weiß nur zu gut, daß das bloß ein schlechter Witz ist.) Das hat die Reisenden schon immer magisch angezogen, seit Jakob Wassermann anno 1563 "Das Gold von Caxamalca" geschrieben hatte. [Die unterschiedliche Schreibweise darf Euch nicht stören, liebe Leser; damals wurde im Spanischen sowohl das "x" als auch das "j" zwischen Vokalen in etwa ausgesprochen wie ein französisches "j" in "Journal" - Manche meinen auch wie ein deutsches "sch", aber jedenfalls nicht wie ein deutsches "x" oder wie ein spanisches "jota" heute. Das galt übrigens auch für México bzw. Méjico und Don Quixote bzw. Quijote.] Leider ist jenes lesenswerte Büchlein heute weitgehend in Vergessenheit geraten; in den Hinterköpfen der [Halb-]"Gebildeten" unserer Zeit hat sich vielmehr ein ebenso simples wie falsches Märchen festgesetzt, das der wahren Geschichte "Lateinamerikas" Hohn spricht. Wie war das gleich? Der böse Pizarro kam eines Tages mit noch ein paar spanischen Räubern ins blühende Inkareich, zog nach Cuzco, setzte den Oberinka gefangen, erpreßte von den Indios ein riesiges Lösegeld, brachte den Inka dann trotzdem um, ermordete die Indios, zerstörte ihre Kultur und segelte mit ihrem Gold zurück nach Spanien, ein despotisches Kolonialreich zurück lassend. Ja, so einfach machen es sich unsere Schulbuch-Autoren - aber warum sollten sie es auch kompliziert machen? Ihre Ergüsse sollen schließlich nur zur Verblödung politisch-korrekten Wahlviehs in spe dienen.
![[Pizarros 1.- 3. Reise]](pizarrosreisen.jpg)
Doch die historische Wahrheit ist, wie so oft, weniger simpel: Francisco Pizarro war schon einige Male erfolglos ins Reich der Inca gereist, war inzwischen Mitte (einige meinen sogar Ende) 50 - also für damalige Vorstellungen ein alter Mann, zumal wenn man an die Strapazen solcher Reisen dachte - und wollte sich schon in Panamá zur Ruhe setzen, als er Nachrichten über "Tahuantinsuyu", das Reich der vier Weltgegenden (so nannten die Inca ihr Herrschaftsgebiet) erhielt, aus denen er schloß, daß sich ihm, seinen [Halb-]Brüdern und Vettern (die er aus der Extremadura, der armen spanischen Randprovinz zu Portugal, nachholte) doch noch einmal die Chance zum großen Coup bieten könnte: Das Incareich war 1528 von einer unbekannten Seuche heimgesucht worden, die eine sechsstellige Anzahl Todesopfer forderte, darunter den brutalen Diktator Huayma Capac (Heini den Großen), der den riesigen Raubstaat (er umfaßte inzwischen fast die ganze Westhälfte Südamerikas - neben den einstigen Kulturen von Chavin, Mochicas, Nazca, Tiahuanaco, Chimu und Huari hatte er wohl auch weite Teile des heutigen Brasilien unterworfen, wie wir seit einigen Jahren fleißiger Ausgrabungen am Amazonas wissen -, mit Ausnahme Süd-Chiles, wo sich die Arauca der Eroberung erfolgreich widersetzt hatten) mit härtester Unterdrückung der unterworfener Völker zusammen gehalten hatte. Auf dem Sterbebett hatte er den Fehler seines Lebens begangen: Statt zu verfügen, daß Huáscar - der älteste Sohn seiner ältesten legitimen Frau und Schwester, der Coya - sein Nachfolger wurde und alle anderen potentiellen Erben töten zu lassen - wie das sonst üblich war -, hatte er Huáscar zwar zum Haupterben und Herrscher des Kernlandes (des heutigen Perú und des heutigen Bolivien) in Cuzco eingesetzt; aber zugleich hatte er Atahuallpa, dem Sohn einer Nebenfrau, die Nordprovinzen (das heutige Ecuador) mit der Hauptstadt Quito (nicht der heutigen Stadt - die wurde erst 1534 von Sebastián de Benalcázar gegründet -, sondern ihrer Vorgängerin) vermacht, die er gerade erst erobert hatte. (Jene Nebenfrau war eine Tochter des letzten dortigen Herrschers, den er - wie alle männlichen Angehörigen des Cara-Volkes - abschlachten und in den Jahuarcocha [Blutsee] werfen ließ.)
![[Huáscar]](huascarholzschnitt.jpg)
![[Atahuallpa]](atahualpa.jpg)
Wir wissen nicht, wer den Bruderkrieg begann und aus welchem Grunde; wir wissen nur, daß Atahuallpa ihn gewann, seinen [Halb-]Bruder Huáscar gefangen nahm und im Gefängnis ermorden ließ; ferner, daß er alle Völker und Stämme ausrotten ließ, die Huascar im Bruderkrieg unterstützt hatten und nicht rechtzeitig geflohen waren. Pizarro spekulierte richtig darauf, daß diese Leute ihn als Befreier begrüßen würden. (Daß sie das taten, weil sie ihn für den wiederauferstandenen Gott Viracocha hielten, dürfte ein Märchen aus einer Zeit sein, als die Indios schon oberflächlich christianisiert und für solche Geschichtchen empfänglich waren.) Also nahm Pizarro einen Kredit auf, reiste nach Spanien, ließ sich von der Königin zum "Capitán general" und "Gobernador" ernennen, trommelte 180 Söldner zusammen (das ist wörtlich zu nehmen - damals wurden Landsknechte und Söldner mit Trommeln angeworben, der Ausdruck hat sich bis heute erhalten), von denen ca. drei Dutzend sogar Pferde und fast ebenso viele Armbrüste gehabt haben sollen - der Rest hatte immerhin Säbel aus Eisen oder Stahl - und segelte mit ihnen Richtung "Perú" (das war eine Verballhornung von "Birú" - so bezeichneten die Indios den Küstenstrich, in den der Fluß Rimac mündete - dessen Name später zu "Lima" verballhornt wurde). Er landete in Tumbes, im Süden der Bucht des Heiligen Matthäus (so hieß sie damals, heute heißt sie Bucht von Guayaquil), marschierte schnurstracks nach Cajamarca und...
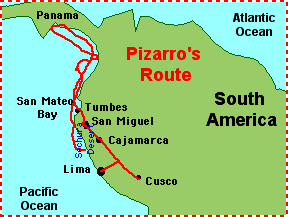
Vergeßt es, liebe Leser, auch das ist zu simpel; denn es war ein mörderischer Zug über die Berge, und die Wege verliefen alles andere als schnurstracks, wanden sich vielmehr in Serpentinen, die aus jeder "Luftlinien"-Entfernung ein vielfaches am Boden machten, dazu noch in der verdammt dünnen Höhenluft der Anden. Pizarro schleppte sich und seine Leute also mit Ach und Krach nach Cajamarca, und als Atahuallpa die Unvorsichtigkeit beging, ihn dort aufzusuchen, nahm er ihn kurzer Hand gefangen. Klugerweise verhinderte er eigenhändig, daß die Spanier den Inca-Usurpator gleich umbrachten (Pizarro wurde dabei von seinen eigenen Leuten an der Hand verwundet - ansonsten hatten die Spanier bei der Gefangennahme keinen einzigen Toten und keinen einzigen Verwundeten zu beklagen) und ließ sich das in Gold aufwiegen. Atahuallpa rettete das freilich nicht: Die Spanier machten ihm wegen der Ermordung seines Bruders Huáscar, des rechtmäßigen Herrschers, den Prozeß, verurteilten ihn zum Tode und richteten ihn hin. Dann zogen sie (d.h. die Brüder Pizarros; Francisco selber kehrte an die Küste zurück, wo er - unweit östlich der Hafenstadt Callao und unweit des alten Vor-Inca-Heiligtums von Pachacamac die "Ciudad de los Reyes [Stadt der Könige]" am Rimac/Lima gründete, die später nur noch nach dem letzteren benannt werden sollte) nach Cuzco und setzten dort einen Halbbruder Huáscars und Atahuallpas auf den Thron, einen gewissen Manco Capac. So weit, so gut.
![[Manco Capac]](mancocapac.jpg)
Aber Manco war nicht nur ein Langohr (so nannten die Spanier den Inca-Adel, wegen der schweren goldenen Ohrgehänge, die seine Angehörigen trugen) sondern auch ein Schlitzohr: Bei der ersten besten Gelegenheit stahl er sich davon, sammelte Truppen und fiel über die nichts ahnenden Spanier her. Fast alle im Lande - und das hieß meist auf dem Lande - wurden ermordet, bis auf die kleinen Garnisonen in den Städten Cuzco, Lima und Trujillo, die sich halten konnten, weil sie von den Indios unterstützt wurden, die unter den Spaniern zum ersten Mal seit Menschengedenken eine milde Regierung erfahren hatten und den Inca keine Träne nachweinten. Der Kampf um Cuzco, die alte Hauptstadt, war am erbittertsten; Manco und seine Truppen brannten es größtenteils nieder - nicht die Spanier, die es verteidigten und später wieder aufbauten! Dann bekamen die Spanier Verstärkungen aus Mittelamerika, Mancos Aufstand brach zusammen (auch weil ihm die eigenen Leute davon liefen), und alles war Friede, Freude, Eierkuchen... Von wegen: Nun begann der Bürgerkrieg erst richtig, nämlich zwischen den spanischen Truppenführern! Die Anhänger Pizarros besiegten die Anhänger seines Jugendfreundes Diego de Almagro; Pizarros Bruder Hernando ließ ihm den Prozeß machen, wegen "Conspiracy to wage war" - einer Anklage, die sich 400 Jahre später in Nürnberg, der damals reichsten Stadt Deutschlands, wiederholen sollte - und ihn hinrichten; drei Jahre später nahm dessen Sohn, Diego de Almagro jun., Rache, indem er Francisco Pizarro und einen seiner Brüder ermordete; Hernando entkam nach Spanien, wo ihm nun seinerseits der Prozeß gemacht wurde, wegen Rechtsbeugung (das ist leider keinem der Nürnberger Richter und Ankläger widerfahren); er wurde zum Tode verurteilt, aber später begnadigt. Das interessierte freilich in Perú - oder, wie man es inzwischen nannte, "Neu-Kastilien" - niemanden; die dort zurück gebliebenen Spanier führten den Bürgerkrieg noch zwei Generationen lang munter weiter; sie sorgten dafür, daß der zahlenmäßige Anteil der Spanier gering blieb und legten so den Grundstein dafür, daß Peru, Bolivien und Ecuador heute fast reine Indio-Staaten und trotz ihrer reichen Bodenschätze arm geblieben sind, während es in den übrigen Ländern Südamerikas immer noch einen erklecklichen Anteil weißen Blutes gibt, dessen Träger ein klein wenig Wohlstand für alle erwirtschaften - das der Pizarro & Co. wurde damals mehr oder weniger sinnlos vergossen. Sinnlos, weil all das Gold und Silber, das sie nach Spanien brachten, dem Land keinen Reichtum brachte, sondern erst die Inflation und am Ende den Staatsbankrott; denn Zahlungsmittel kann man nun mal nicht essen, sondern, wie schon der Name sagt, nur tauschen gegen Waren, die erstmal da sein müssen - das können sie aber nicht, wenn allzu viele Leute glauben, es sei besser, Edelmetalle auszubuddeln als etwas Eßbares (oder sonstwie Brauchbares) zu produzieren - dann steigen nur die Preise. Wahren Reichtum, liebe Leser, erwirbt man nicht durch das Ausplündern fremder Tempel, sondern durch eigene Arbeit!
![[Francisco Pizarro]](pizarro.jpg)
![[Diego de Almagro]](almagronl.jpg)
![[Pedro de Alvarado]](alvaradopedro.jpg)
![[José de San Martín]](sanmartin.jpg)
![[Simón Bolívar]](bolivar.jpg)
![[Antionio Sucre]](sucre.jpg)
Zurück ins 19. Jahrhundert. Die meisten Historiker glauben nicht, daß jenes Treffen in Cajamarca statt fand; sie tippen vielmehr auf Guayaquil im heutigen Ecuador, einige auch auf Lima, möglichst im Palast der Hauptstadt, denn das macht sich besser, wenn man Legenden weben will; und früher - als noch nicht der Jugendlichkeits-Wahn eingerissen war - machte es sich auch besser, wenn man die Helden ein wenig auf alt-ehrwürdig trimmte; tatsächlich sollte keiner der drei so alt werden wie er auf den Portraits oben aussieht, geschweige denn daß einer von ihnen auf Reisen (zur ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes schreibt Dikigoros an anderer Stelle mehr) eine so schöne Gala-Uniform angehabt hätte - besonders Simón war berühmt-berüchtigt für sein "Räuber-Zivil". Alle drei haben in Europa die Napoléonischen Kriege mit erlebt und die Unterwerfung der europäischen Völker unter das französische Joch - Spanien wurde besonders brutal und grausam unterdrückt; in ihrem jugendlichen Leichtsinn haben die drei das jedoch ganz anders empfunden, nämlich als "Befreiung". Befreiung wessen wovon wozu? pflegt Dikigoros heute in solchen Fällen zu fragen; aber als er jünger war, etwa wie Toni damals, hätte er wohl auch noch nicht so gefragt. In Südamerika herrschen allenthalben böse Diktatoren, die ihre armen Untertanen grausam unterdrücken - so empfinden das jedenfalls viele, vor allem Außenstehende, besonders im fernen Europa, wo sich die Perspektiven leicht verengen. Zu allem Überfluß sind diese Diktatoren meist spanischer Herkunft. (Allein in Chile sitzt ein gewisser O'Higgins, der irische Vorfahren hat.) Jo, Simón und Toni haben viele Jahre in Europa studiert, vor allem in Spanien. Sagen wir es ruhig: Sie sind Spanier reinsten Wassers - nicht nur abstammungsmäßig, sondern auch von ihrem ganzen Lebenshorizont her, hinter dem die eingeborenen Indios Südamerikas unsichtbar bleiben. (Die Arbeit, für die sich die weiße Oberschicht zu fein ist, tun Neger-Sklaven - die Indios gelten für solche Dienste als zu faul und zu aufsässig.) Sie leben in getrennten Welten, sprechen die Sprache der Indios nicht und können so auch deren Denkweise nicht verstehen. Doch da sie in Südamerika geboren sind, fühlen sie sich nicht als "Gachupines" [Schimpfwort für auf der Iberischen Halbinsel geborene Spanier], sondern als "Criollos" [in Südamerika "ein"-geborene Spanier]. Ob die Herrschaft der "Gachupines" in Südamerika tatsächlich auch nur halb so grausam und brutal ist wie etwa die Napoléons in Europa können sie nicht beurteilen (Dikigoros wagt es ganz entschieden zu bezweifeln), aber das interessiert sie nicht. Sie sind her gekommen, um die Freiheit zu suchen und zu finden, die Freiheit Südamerikas vom spanischen Kolonial-Joch. Eigentlich wollten sie gemeinsam ganz Südamerika bereisen, auf dem "camino hacia la libertád" (so nennen sie nun die Route, die der deutsche Reisende Alexander v. Humboldt kurz zuvor noch die "Straße der Vulkane" genannt hatte); aber dann gibt es Differenzen. Die Berufs-Historiker rätseln bis heute herum, warum und wieso, denn es sind keine Aufzeichnungen überliefert, und anders als zur Geschichte des 20. Jahrhunderts gibt es hierzu auch keine staatlich vorgeschriebene und strafbewehrte Version, die man offiziell glauben müßte. Waren sie vielleicht so vernünftig, daß sie vermeiden wollten, daß ihre Geschichte so endete wie die ihrer Vorgänger - die sie selbstverständlich kannten - vor rund 300 Jahren? Aber solchen Erklärungen, die aus der Rückschau irgendwelche "vernünftigen" Motive konstruieren wollen, mißtraut Dikigoros grundsätzlich; er glaubt nicht an die Vernunft als Antriebskraft des Handelns der Menschen und somit der Geschichte und ihrer "Macher", denn die Vernunft zählt nun mal nicht zu den natürlichen Trieben des Menschen - die erschöpfen sich vielmehr im Freß-, Sex- und Zerstörungstrieb. Was kann es dann gewesen sein? Darf Dikigoros aus eigener Erfahrung eine Vermutung äußern? Simón war das, was man anderthalb Jahrhunderte später einen "Ethno-Linken" nennen wird: Er hatte seine Mutter nie richtig gekannt (seinen Vater auch nicht - beide waren früh gestorben), war von einer schwarzen Amme groß gezogen worden und hatte, als er erwachsen wurde, als erstes die zweitausend Neger-Sklaven seines Vaters in die Freiheit entlassen; er konnte nur mit schwarzen Frauen - und hier im örtlichen Puff fand er endlich mal welche.
Exkurs. Daß Bolívar in Spanien mal mit einer Weißen verheiratet gewesen sein soll - obwohl er die "Gachupines" doch so haßte -, die gleich darauf gestorben sei, und daß er deshalb keine andere Frau mehr geheiratet habe, hält Dikigoros für ein Gerücht, das seine Hof-Biografen ausgestreut haben. Natürlich konnte damals ein weißer Hidalgo - und sei er auch "Criollo" - noch keine Negerin heiraten. Einige meinen sogar, daß er selber ein "Zambo" gewesen sei, da eine seine Urgroßmütter eine Negersklavin gewesen sei. Der kolumbianische Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez - selber ein "Zambo" - schreibt in seiner Bolívar-Biografie Der General in seinem Labyrinth: "Das früheste Portrait, eine anonyme Miniatur aus Madrid, zeigte ihn als 16-jährigen. Mit 32 wurde er auf Haïti gemalt, und beide Bilder spiegelten getreu sein Alter und seine karibische Herkunft. Eine Linie seiner Vorfahren hatte durch einen Urgroßvater, der mit einer Sklavin ein Kind hatte, afrikanisches Blut, und das prägte seine Gesichtszüge offensichtlich. Aber als sein Ruhm wuchs, begannen die Maler, ihn zu idealisieren, sie wuschen sein Blut, bis er mit dem römischen Profil seiner Statuen ins öffentliche Andenken einging." Dikigoros ist freilich von der Authentizität jener beiden frühen Portraits nicht restlos überzeugt; gleichwohl will er sie seinen Lesern nicht vorenthalten, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Exkurs Ende.
![[Bolívar mit 16?]](bolivar16.jpg)
![[Bolívar mit 32?]](bolivar1815.jpg)
![[Bolívar]](simonbolivar3.jpg)
![[Bolívar als 'Libertador']](bolivarlibertador.jpg)
Wie dem auch sei, der prüde, gut katholische Jo schlug innerlich die Hände über dem Kopf zusammen ob jenes Herumhurens und fragte sich, warum ihn Gott bloß so gestraft hatte mit diesen beiden Typen. Nach einem mittelgroßen Streit trennten sich die drei: Jo zog nach Süden, ins heutige Chile und Argentinien; Simón zog nach Norden, ins heutige Ecuador, Kolumbien und Venezuela (wo er aus dem "Vizekönigreich Neu-Granada" die "Republik Kolumbien" machte); Toni blieb in Peru-Bolivien (das damals noch nicht geteilt war), und alle drei wurden berühmt. In den Wappen ihrer Länder herrschte eitel Sonnenschein, und die Füllhörner quellen über - wie schön.
![[Wappen]](wappenperu1820.jpg)
![[Wappen]](wappenargentina1813.jpg)
![[Wappen]](wappenuruguay.jpg)
![[Wappen]](wappenvenezuela1830.jpg)
![[Wappen]](wappenkolumbien1821.jpg)
![[Wappen]](wappenecuador1830.jpg)
So haben die Historiker späterer Jahre unseren drei Helden denn auch klangvolle Beinamen verliehen, wie "Befreier [Libertador]" oder "Beschützer [Protector]". (Das war damals noch nicht cynisch gemeint, liebe Leser, es gab ja noch keine Besatzungszonen, die "Protektorate" genannt wurden, und keine amerikanischen "Liberator"-Bomber, die die Menschen von ihren Häusern und Wohnungen - und oft auch Leben - "befreiten". Gleichwohl haßte Bolívar jenen Beinamen - er wollte lieber "Pacificador [Peacemaker]" genannt werden.) Dikigoros würde San Martín, Bolívar und Sucre eher als Narren (nicht umsonst heißt der Ort in Venezuela, an dem die Entscheidungsschlacht gegen die Spanier statt fand, "Carabobo [Narrengesicht]" :-) oder Naïvlinge bezeichnen (ebenso wie ihre mexikanischen Zeit- und Schicksals-Genossen Hidalgo, Morelos und Iturbide); denn sie, die sie selber Spanier waren, wurden in ihrem kindischen Streben nach vermeintlicher "Freiheit" zu Totengräbern der spanischen Kultur in Südamerika, ohne zu wissen, was sie damit zu Grabe trugen. Nein, es war durchaus nicht alles Gold, was während der spanischen Kolonial-Zeit geglänzt hatte; aber es war nicht annähernd so schlimm wie das, was danach kommen sollte. Rückblickend ist Dikigoros überzeugt, daß damals der Grundstein gelegt wurde zu einer Entwicklung, die letztendlich zum Ruin Südamerikas geführt hat, wie er sich uns heute offenbart - aber wir wollen nicht vorgreifen. Nur so weit: Acht Jahre nach jenem famosen Treffen sind alle von den dreien gegründeten Staaten auseinander gebrochen, es herrschen Bürgerkriege und Hungersnöte; Toni der Gezuckerte ist ermordet worden (er liegt in Quito begraben), Simón Bolívar an den Folgen einer Geschlechtskrankheit verreckt, und Jo, der heilige Martin - der es noch am besten getroffen hat - nach Europa geflohen, wo er als Asylant, pardon, damals sagte man ja noch Exilant, sterben wird. Pikanter Weise hatte er sich nach Frankreich begeben, obwohl sein Vorbild Napoléon längst gescheitert, erst nach Elba und dann nach Sankt Helena verbannt worden ist, auf halbem Weg nach Argentinien, Jo's Heimat, die er "befreit" und die sich anschließend von ihm "befreit" hat. Hätte es da nicht nahe gelegen, wenn die beiden ihren Lebensabend gemeinsam auf jener Atlantik-Insel verbracht hätten? Aber aus freien Stücken wollte unser Freiheitsheld dieses Schicksal offenbar nicht teilen - den Treppenwitz der Geschichte hat uns der Neid der Götter wohl nicht gegönnt... Wie dem auch sei: Die Reise hat sich gelohnt!
![[When we were young]](perustud.jpg)
![[When we were young]](peruangler.jpg)
![[When we were young]](peruinoel.jpg)
Irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, irgendwo in Perú, sitzen drei höher-semestrige - böse Zungen würden sagen: verbummelte - Studenten in einem mittelprächtigen Gasthaus und blasen Trübsal. Posemuckel in den Anden. Draußen regnet es, schon seit Tagen. Sintflutartig. Eisenbahn-Schienen sind weg gespült, Straßen stehen unter Wasser, Flüge fallen aus, da die ohnehin primitiven Landebahnen sich in Seen verwandelt haben, der Zeitplan ihrer Reise ist längst ins Wasser gefallen, und Melone hat Soroche - das ist die spanische Bezeichnung für Höhenkrankheit. Ausgerechnet der, denkt Tarzan, dabei ist er doch am kleinsten, da unten ist die Luft doch gar nicht so dünn. [Wieso kommt Dikigoros hier ausgerechnet auf Posemuckel? Gibts das überhaupt? Und ob, liebe Leser, und ob. Als sein Großvater so alt war wie Tarzan damals - Machu Picchu war noch keine zehn Jahre wiederentdeckt -, war er gerade dort und mußte auch warten, bis der Regen nachließ. Er wartete zwar nicht auf Busse oder Eisenbahnen, geschweige denn auf Flugzeuge, aber er hatte noch einen weiten Weg vor sich von seiner Heimat in Posen - das nach dem Ersten Weltkrieg an die Polen gefallen war - nach Hamburg, und die alten preußischen Armee-Stiefel - anderes Schuhwerk besaß er nicht - mußten den weiten Weg, den er noch - zu Fuß, wie einst die Konquistadoren - vor sich hatte, aushalten, denn Posemuckel an der Obra war noch nichtmal die halbe Miete. Vielleicht hinkt der Vergleich, denn die Zerstörung der deutschen Kultur in Ostmitteleuropa durch die Polen, Russen, Tschechen und Ungarn war sicher weit schwer wiegender als die der Inca-Kultur durch die Spanier, auch wenn so zu denken heute politisch inkorrekt ist; aber Tatsache ist wohl, daß es um die Inca nicht sonderlich schade war, und daß auch die von ihnen zerstörten alten Kulturen in Südamerika nicht annähernd das Niveau derer gehabt hatten, welche die Azteken kurz vor Ankunft der Spanier in Mexiko zerstört hatten.]
Melone denkt daran, daß er ursprünglich eine ganz andere Route vorgeschlagen hatte, mit und auf der sie sicher besser gefahren wären: Hinflug nach Bogotá, über Land durch Kolumbien und Ecuador bis Guayaquil, von dort mit dem Flugzeug nach Iquitos am Amazonas, dann im Dampfer bis zu dessen Mündung in den Atlantik, und dann durch die Nordostprovinzen Brasiliens bis Recife, von dort Rückflug; und den Rest - den Süden Südamerikas - hätte man sich auf einer weiteren Reise vornehmen können... [Dikigoros Schwester Helli hat jenen Nordtrip ein paar Jahre später zusammen mit ihrem Verlobten gemacht; und sie waren maßlos enttäuscht - vor allem von der Fahrt auf dem Amazonas: "Da sieht man links und rechts bald nichts mehr als Wasser und Grünzeug; und die Indio-Siedlungen, die ab und zu auftauchen, kannste auch vergessen." Sie haben also nichts versäumt - aber das weiß Melone ja nicht - und er würde es auch nicht wahr haben wollen: Wo er hin kommt, da gibt es immer was zu sehen, man muß eben nur die Augen aufmachen, und wenn andere Reisende keine im Kopf haben, dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie nachher enttäuscht sind.] Statt dessen sind sie nach Caracas geflogen, von dort mit dem Überlandbus nach Bogotá gefahren und haben von dort ein Flugzeug nach Lima genommen - von wo sie auch wieder zurück fliegen wollen, und nun hängen sie hier fest. [Dikigoros glaubt bis heute, daß diese Anflugroute gut gewählt war, denn in Caracas kann man sich von allen südamerikanischen Metropolen wahrscheinlich am besten akklimatisieren. Den Rest der Reiseroute würde auch er heute teilweise anders planen; aber erstens ist man hinterher immer klüger, und zweitens kann man gegen unvorhergesehene Naturkatastrofen nicht anplanen - da ist dann halt Improvisation gefragt.]
So hängt jeder seinen Gedanken nach. Lulatsch fragt sich, wie der Zufall ausgerechnet ihn und diese beiden Typen zusammen geführt hat. Nun, jeder von ihnen wollte vor Abschluß des Studiums noch einmal die akademische Freiheit auskosten und eine Rundreise durch Südamerika machen; aber es sind böse Zeiten, da befährt man den Weg der Freiheit nicht gerne allein. Freilich versteht unter "bösen Zeiten" jeder etwas anderes: In Südamerika herrschen allenthalben böse Diktatoren, die ihre armen Untertanen grausam unterdrücken - so empfinden das jedenfalls viele, vor allem Außenstehende, besonders im fernen Europa, wo sich die Perspektiven leicht verengen. Zu allem Überfluß sind diese Diktatoren zumeist deutscher Herkunft:
Alfred(o) Stroessner in Paraguay,
Hugo Banzer in Bolivien und
Ern(e)st(o) Geisel
in Brasilien sollen die schlimmsten sein. [Das hat Tradition, seit zwischen den Weltkriegen die deutschen Ex-Offiziere Hans Kundt und Emil Körner die bolivianische bzw. die chilenische Armee aufbauten.] (Allein in Chile sitzt ein gewisser
Augusto Pinochet,
der französische bretonische Vorfahren hat.) Das bedrückt besonders Melone, der u.a. Völkerkunde studiert. Er will die letzten echten, reinblütigen Indios sehen, bevor sie ganz ausgerottet sind oder - noch schlimmer - vermischt zu Mestizen, die alle schlechten Eigenschaften der Weißen und Roten in sich vereinen, aber in der Regel die guten vermissen lassen. Um sie macht Melone einen weiten Bogen - er hält sie für die Hauptursache der rasant ansteigenden Kriminalität, von der er in seinen klugen Büchern und Zeitungen soviel gelesen hat. Und während die Kriminalitätsrate ansteigt, sinkt die Zahlungsfähigkeit der südamerikanischen Wirtschaft und der Wechselkurs ihrer Währungen ebenso rasant - kein Wunder, daß inzwischen so viele den Pleitegeier im Wappen führen und die Sonne, so sie denn überhaupt noch scheint, ziemlich griesgrämig aus der Wäsche guckt!
![[Wappen Columbia]](wappenkolumbien1955.jpg)
![[Wappen Ecuador]](wappenecuador.jpg)
![[Wappen Bolivien]](wappenbolivien.jpg)
Das betrübt auch und vor allem Lulatsch, den Studenten der Volkswirtschaft und Fuxmajor einer nicht-schlagenden katholischen Studenten-Verbindung. Er bedauert vor allem den Verfall des Glaubens in diesen einst so frommen Ländern, und darin sieht er auch die Ursache für ihren politischen und gesellschaftlichen Niedergang. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt Südamerika - wie schon nach dem Ersten Weltkrieg - als eine der Regionen mit den rosigsten Zukunfts-Aussichten weltweit; aber die optimistischen Prognosen haben sich einmal mehr als überzogen erwiesen. Allein hätte Lulatsch sich nicht mehr her getraut, obwohl er selbst den großen und kräftigen Jura-Studenten Tarzan noch um Hauptes Länge überragt; er spricht ja nicht mal Spanisch und Portugiesisch, wie Tarzan, geschweige denn Ketschua und Aymará, wie Melone. (Der hat jedenfalls behauptet, diese alten Indio-Sprachen an der Universität, bei den "Altamerikanisten", gelernt zu haben; doch bald stellt sich heraus, daß er da wohl geschwindelt hat - oder die blöden Indios können ihre eigenen Sprachen nicht mehr; Melone schafft es jedenfalls nicht, sich ihnen verständlich zu machen.) Lulatsch bringt vor allem Kontakte mit: Sein Vater arbeitet bei einem Weltkonzern, der auch in allen südamerikanischen Ländern Niederlassungen hat, und er kennt viele Mitarbeiter persönlich; das sind praktische Anlaufstellen, wenn die Hotels und Restaurants mal voll oder unerschwinglich sein sollten. Er will sich ein Bild von den späteren Berufsmöglichkeiten machen, und natürlich auch von den christlichen Sehenswürdigkeiten: der Jesuiten-Kirche in Quito, dem Erzbischofs-Palast in Lima und der Christus-Statue in Rio de Janeiro. Genauer gesagt nicht ein, sondern ein paar tausend Bilder - er schleppt ein Kamera-Ausrüstung und einen ganzen Koffer voller Filme mit.
![[Die Jesuitenkirche in Quito]](lacompania.jpg)
![[Der erzbischöfliche Palast in Lima]](limapalast.jpg)
![[Der Cristo Rey auf dem Corcovado von Rio de Janeiro]](corcovado.jpg)
Dagegen hält Tarzan die Menschen für nicht so wichtig - die kommen und gehen und bleiben sich doch immer gleich. Heute kommt ihm diese Einstellung unglaublich naïv vor; aber damals hatte er noch den brav auswendig gelernten Spruch "alle Menschen sind gleich" im Hinterkopf und nur diejenigen Teile der Welt gesehen, die diesen weit verbreiteten Irrglauben aufrecht erhalten konnten.
Längerer Nachtrag: Im Rückblick, als alter Mann, fragt sich Dikigoros, wie er zu einer so abstrusen Weltanschauung kommen konnte, ja wie man überhaupt zu einer Weltanschauung kommt. Um mit dem bereits erwähnten Alexander von Humboldt zu sprechen: "Am besten, indem man sich die Welt mit eigenen Augen anschaut." Ja, aber bevor man das dazu notwendige Alter erreicht hat, hat man sich sein Weltbild doch schon weitgehend gemacht und kann es allenfalls noch korrigieren. Wie, wo und wann aber wird es vorgezeichnet? Dikigoros hat mühsam in seinem Gedächtnis gekramt und glaubt jetzt, die Antwort gefunden zu haben - jedenfalls für sich persönlich: Es war in den 1950er Jahren, als sie gerade nach Bonn gezogen waren, in die Koblenzer Straße, genauer gesagt in den Teil, der heute, nach dem Tod des ersten Bundeskanzlers, "Adenauerallée" heißt und in nur 150-200 m Abstand parallel zum Rhein verläuft, zu dem die so genannten "Fährgassen" hinunter führten, auf denen man im Winter - damals waren die noch richtig kalt, und der Schnee blieb Tage und Wochen lang liegen - prima rodeln konnte. Besonders beliebt war die 2. Fährgasse, denn sie war nur leicht abschüssig, d.h. man riskierte keine allzu rasante Abfahrt und brauchte den Schlitten auch nicht so steil wieder hoch zu ziehen. Daneben stand ein Gebäude, das damals zum Postministerium gehörte. Und an dessen Rückwand, hoch über der Rodelbahn, waren einige Tierfiguren angebracht, bei denen klein Niko nicht ganz klar war, was sie bedeuten sollten.

Also fragte er eines Tages seinen Vater, und der meinte: "Das sollen wohl die fünf Erdteile sein." (In der Tat hatte ein gewisser Hans Wimmer jene Bronzefiguren eben zu diesem Behuf modelliert; aber damals
 stand noch keine erklärende Tafel vor dem Eingang zum Hauptgebäude, und ein Internet, wo man das hätte nachlesen können, gab es auch noch nicht :-) Nun ging Niko zwar schon auf die Volkschule - und die war nicht etwa schlecht, denn es war eine katholische Konfessionsschule, und er hatte auch schon die Namen vieler Tiere gelernt, die Noah in seiner Arche mit genommen hatte, um sie vor der Sintflut zu retten; aber in den ersten vier Klassen gab es noch keinen Erdkunde-Unterricht (geschweige denn, daß man den hochtrabend auf Küchen-Lateinisch als "Geographie-Unterricht" bezeichnet hätte, wie später auf dem Gymnasium; erst recht bezeichnete man Erdteile nicht als "Kontinente", denn auch und gerade wer Lateinisch kann weiß doch, daß das "Zusammenhängende" bedeutet; und "Erdteil" meint ja ganz im Gegenteil die Landmassen, die durch die "sieben Weltmeere" von einander getrennt, d.h. geteilt sind :-) sondern nur das Fach "Heimatkunde". Da hatte er etwas über das Rheinland erfahren, über das Vorgebirge, das Siebengebirge, den Ennert, den Kottenforst und die Eifel, aber viel weiter reichte sein Horizont noch nicht - abgesehen davon, daß die Oma in Norddeutschland wohnte, an der Ostsee, wo man sie jeden Sommer in den Ferien besuchte. "Aber das sind doch Tiere!?" - "Ja," meinte Urs, aber sie symbolisieren die fünf Erdteile." - "Und welches Tier symbolisiert welchen Erdteil?" - "Das ist doch ganz einfach," meinte Urs, "fangen wir mal an, von links nach rechts. Der Stier steht natürlich für Europa." Aber Niko hatte schon die griechischen Götter- und Heldensagen von Gustav Schwab - die damals noch nicht so stark zensiert waren wie heute - gelesen und wußte es besser: "Europa war doch eine Kuh, und der Stier war Zeus!" - "Na wenn schon, der kam ja auch aus Europa. Und der Adler symbolisiert natürlich Amerika, der ist dort das Wappentier." - "Dann ist der Elefant sicher das Symbol für Indien?" - "Aber Niko, Indien ist doch kein Erdteil. Der Elefant steht natürlich für Afrika!" - "Und der Hund daneben?" - "Äh..." Nach einigem Nachdenken kam Urs darauf, daß das wohl kein Hund sein sollte, sondern vielmehr ein Löwe. Und da der sonst nirgendwo hin paßte, mußte er wohl für Afrika
stand noch keine erklärende Tafel vor dem Eingang zum Hauptgebäude, und ein Internet, wo man das hätte nachlesen können, gab es auch noch nicht :-) Nun ging Niko zwar schon auf die Volkschule - und die war nicht etwa schlecht, denn es war eine katholische Konfessionsschule, und er hatte auch schon die Namen vieler Tiere gelernt, die Noah in seiner Arche mit genommen hatte, um sie vor der Sintflut zu retten; aber in den ersten vier Klassen gab es noch keinen Erdkunde-Unterricht (geschweige denn, daß man den hochtrabend auf Küchen-Lateinisch als "Geographie-Unterricht" bezeichnet hätte, wie später auf dem Gymnasium; erst recht bezeichnete man Erdteile nicht als "Kontinente", denn auch und gerade wer Lateinisch kann weiß doch, daß das "Zusammenhängende" bedeutet; und "Erdteil" meint ja ganz im Gegenteil die Landmassen, die durch die "sieben Weltmeere" von einander getrennt, d.h. geteilt sind :-) sondern nur das Fach "Heimatkunde". Da hatte er etwas über das Rheinland erfahren, über das Vorgebirge, das Siebengebirge, den Ennert, den Kottenforst und die Eifel, aber viel weiter reichte sein Horizont noch nicht - abgesehen davon, daß die Oma in Norddeutschland wohnte, an der Ostsee, wo man sie jeden Sommer in den Ferien besuchte. "Aber das sind doch Tiere!?" - "Ja," meinte Urs, aber sie symbolisieren die fünf Erdteile." - "Und welches Tier symbolisiert welchen Erdteil?" - "Das ist doch ganz einfach," meinte Urs, "fangen wir mal an, von links nach rechts. Der Stier steht natürlich für Europa." Aber Niko hatte schon die griechischen Götter- und Heldensagen von Gustav Schwab - die damals noch nicht so stark zensiert waren wie heute - gelesen und wußte es besser: "Europa war doch eine Kuh, und der Stier war Zeus!" - "Na wenn schon, der kam ja auch aus Europa. Und der Adler symbolisiert natürlich Amerika, der ist dort das Wappentier." - "Dann ist der Elefant sicher das Symbol für Indien?" - "Aber Niko, Indien ist doch kein Erdteil. Der Elefant steht natürlich für Afrika!" - "Und der Hund daneben?" - "Äh..." Nach einigem Nachdenken kam Urs darauf, daß das wohl kein Hund sein sollte, sondern vielmehr ein Löwe. Und da der sonst nirgendwo hin paßte, mußte er wohl für Afrika stehensitzen. Wohin aber mit dem Elefanten? Dann fiel der Groschen: Der stand für Asien! "Aber du hast doch gesagt, daß Indien kein Erdteil ist; und wo außer in Indien gibt es denn in Asien Elefanten? In China? In Japan?" - "Na ja, er steht eben symbolisch für ganz Asien, auch für die Länder, wo es ihn nicht gibt. Aber wir hätten gleich drauf kommen müssen, denn dieser Elefant hat ja kleine Ohren, muß also ein indischer, äh... asiatischer sein; die afrikanischen Elefanten haben nämlich größere Ohren." Das leuchte Niko nun weniger ein, denn auch die Löwenmähne war ja deutlich zu klein geraten; er sah vielmehr aus wie einer der berühmten chinesischen Riesenhunde, wie sie dort in Stein gemeißelt die Tempeleingänge bewachen - davon hatte er mal ein Bild gesehen -, hätte also ebenso gut für Asien stehen können. (Wenigstens mit der letzten Figur gab es keine Probleme: Das Känguru stand eindeutig für Australien :-)


Wieder zuhause holte Urs einen Atlas aus dem Schrank - den großen JRO, Jubiläumsausgabe 1954, ein ganz hervorragendes Werk, wie man es heute nicht mehr bekommt -, und zeigte seinen Kindern die Erdteile. "Aber das stimmt ja gar nicht," meinte Niko, "Nordamerika und Südamerika sind doch nicht ein, sondern zwei Erdteile, Europa und Asien sind nicht zwei, sondern nur ein zusammenhängender Erdteil, und die komische Insel da rechts unten ist eigentlich gar keiner." (Er wußte noch nicht, daß jene Insel erst ganz spät zum "Erdteil" befördert worden war. Früher hatte man die riesige Landmasse um den
![[Medaille von K. Goetz 1920]](medschandevs.jpg) Südpol als "terra australis" oder "Australien" bezeichnet. Aber die war ja so schlecht zugänglich; und als dann jemand die besagte Insel entdeckte, beschloß man, sowohl den Namen als auch die "Erdteil"-Eigenschaft auf sie zu übertragen :-) "Natürlich gibt es keine fünf Erdteile," sagte Urs, "es gibt ja auch keine sieben Weltmeere, sondern nur eines, aus dem verschiedene Landmasse empor ragen. Aber es kommt nicht darauf an, was falsch und richtig ist, sondern darauf, was nach Auffassung der Obrigkeit falsch und richtig sein soll. Das mußt du ja auch auf der Schule lernen und beim Abfragen wieder aufsagen. Aber du darfst nicht alles glauben, was man dir dort erzählt, sondern mußt nur so tun als ob. Vieles, was heute als richtig gilt, ist in Wahrheit falsch, und umgekehrt. Am besten, man schaut sich alles mit eigenen Augen an, macht sich selber ein Bild und behält es dann schön für sich. Die Wahrheit zu sagen kann nämlich gefährlich sein, das galt schon in meiner Kinderzeit, heute noch viel mehr, und wenn du erstmal so alt bist wie ich wird es vielleicht noch gefährlicher sein." Das verstand Niko zwar damals noch nicht so ganz, aber er nahm sich fest vor, dereinst alle vier Erdteile - Nordamerika, Südamerika, Eurasien und Afrika - mit eigenen Augen anzuschauen und dabei besonders auf die Tierwelt zu achten, unter besonderer Berücksichtigung der Mähnen- und Ohrengröße. Denn die Menschen waren ja alle gleich - um die Richtigkeit dieses Satzes bestätigt zu finden, brauchte man bloß um sich zu schauen: In Deutschland gab es praktisch nur Deutsche, denn anders als nach dem 1. Weltkrieg, als die französischen Besatzer im Rheinland den Unmut der Besetzten hervor gerufen hatten, indem sie bevorzugt Neger, Indochinesen, Araber u.a. Kolonialtruppen eingesetzt hatten, machten es die Briten nach dem 2. Weltkrieg anders - sei es aus Klugheit, sei es, daß sie aus der Not eine Tugend machen mußten: Indische Truppen gab es ja nicht mehr - die hatten sich selbständig gemacht -, und die ersten Neger waren gerade erst in England angekommen - übrigens nicht aus Afrika, sondern aus der Karibik, aber das ist
eine andere Geschichte
- und noch nicht militärisch ausgebildet; also konnten sie nur Weiße schicken, und die fielen nicht wirklich als "andersartig" auf, zumal sie meist Deutsch sprachen - sprechen mußten, denn die meisten Trizonesier konnten noch kein Englisch; das wurde erst viel später als Pflichtfach an allen Schulen eingeführt. (Auch Niko hatte noch mit Lateinisch als erste Fremdsprache angefangen.)
Südpol als "terra australis" oder "Australien" bezeichnet. Aber die war ja so schlecht zugänglich; und als dann jemand die besagte Insel entdeckte, beschloß man, sowohl den Namen als auch die "Erdteil"-Eigenschaft auf sie zu übertragen :-) "Natürlich gibt es keine fünf Erdteile," sagte Urs, "es gibt ja auch keine sieben Weltmeere, sondern nur eines, aus dem verschiedene Landmasse empor ragen. Aber es kommt nicht darauf an, was falsch und richtig ist, sondern darauf, was nach Auffassung der Obrigkeit falsch und richtig sein soll. Das mußt du ja auch auf der Schule lernen und beim Abfragen wieder aufsagen. Aber du darfst nicht alles glauben, was man dir dort erzählt, sondern mußt nur so tun als ob. Vieles, was heute als richtig gilt, ist in Wahrheit falsch, und umgekehrt. Am besten, man schaut sich alles mit eigenen Augen an, macht sich selber ein Bild und behält es dann schön für sich. Die Wahrheit zu sagen kann nämlich gefährlich sein, das galt schon in meiner Kinderzeit, heute noch viel mehr, und wenn du erstmal so alt bist wie ich wird es vielleicht noch gefährlicher sein." Das verstand Niko zwar damals noch nicht so ganz, aber er nahm sich fest vor, dereinst alle vier Erdteile - Nordamerika, Südamerika, Eurasien und Afrika - mit eigenen Augen anzuschauen und dabei besonders auf die Tierwelt zu achten, unter besonderer Berücksichtigung der Mähnen- und Ohrengröße. Denn die Menschen waren ja alle gleich - um die Richtigkeit dieses Satzes bestätigt zu finden, brauchte man bloß um sich zu schauen: In Deutschland gab es praktisch nur Deutsche, denn anders als nach dem 1. Weltkrieg, als die französischen Besatzer im Rheinland den Unmut der Besetzten hervor gerufen hatten, indem sie bevorzugt Neger, Indochinesen, Araber u.a. Kolonialtruppen eingesetzt hatten, machten es die Briten nach dem 2. Weltkrieg anders - sei es aus Klugheit, sei es, daß sie aus der Not eine Tugend machen mußten: Indische Truppen gab es ja nicht mehr - die hatten sich selbständig gemacht -, und die ersten Neger waren gerade erst in England angekommen - übrigens nicht aus Afrika, sondern aus der Karibik, aber das ist
eine andere Geschichte
- und noch nicht militärisch ausgebildet; also konnten sie nur Weiße schicken, und die fielen nicht wirklich als "andersartig" auf, zumal sie meist Deutsch sprachen - sprechen mußten, denn die meisten Trizonesier konnten noch kein Englisch; das wurde erst viel später als Pflichtfach an allen Schulen eingeführt. (Auch Niko hatte noch mit Lateinisch als erste Fremdsprache angefangen.)
![[5-DM-Gedenkmünze zum Humboldt-Jahr 1967]](5dm1967humboldtav.jpg)
Und dann hatte ihn ausgerechnet Humboldt auf die falsche Fährte gelockt: Der vertrat nämlich die Auffassung, daß es in erster Linie auf die Natur ankomme, nicht auf den Menschen. Und er war damals in aller Mund: Die Bundesregierung hatte sogar 1967 zum Humboldt-Jahr erklärt. Und seine Werke - Reisebeschreibungen - waren allgemein zugänglich, sogar in deutscher Übersetzung. (Niko hatte sie freilich im französischen Original gelesen, in der Bibliothek des Institut français, denn damals lernte man auf deutschen Oberschulen noch Französisch, und für veraltete und fachchinesische Ausdrücke gab es ja Wörterbücher :-) Dagegen hatte er von Carl Ritter - der die gegenteilige Auffassung vertrat, nämlich daß es weniger auf die Natur ankomme als vielmehr darauf, was der Mensch aus ihr mache - noch nichts gehört. Und wenn, dann hätte er trotzdem nichts von ihm gelesen, denn das war ja ein Schreibtischgelehrter, der die Länder, über die er schrieb, nicht selber angesehen hatte; und überhaupt, die lagen ja allesamt in Asien und/oder Afrika, und das stand damals ja nicht zur Debatte. Außerdem hätte er keinen Zugang zu dessen mehrbändigem Hauptwerk "Vergleichende Geographie" gehabt, denn davon gab es keine Neuausgaben, und die alten waren für ihn unerschwinglich. Auch von Friedrich Ratzel - der ähnlich dachte - hatte Dikigoros noch nichts gehört; und wenn, dann hätte er auch den nicht gelesen: Der schrieb ja über Länder wie Frankreich, Italien, USA und Mexiko, die er längst selber bereits hatte und besser zu kennen glaubte als jemand, der schon 70 Jahre tot war. Nein, zur Vorbereitung einer Südamerika-Reise gab es nur eine Pflichtlektüre: Humboldt. Und im Rückblick ist das ja auch gut so: Nun kann Dikigoros in der schönen Gewißheit leben, daß er unabhängig von Ritter und Ratzel zu der richtigen Erkenntnis gelangt ist - eben durch die Reise, über die er hier schreibt. Und um auch noch die Frage zu beantworten, warum Humboldt irrte: Er hatte vor allem Gegenden erforscht, die noch weitgehend vom Menschen unberührt oder jedenfalls nicht nachhaltig verändert waren, z.B. das Amazonas-Becken und die Hoch-Anden - wie hätte er da zu einer gegenteiligen Auffassung gelangen können? Er ist also exculpiert. Längerer Nachtrag Ende.
Zurück in die 1970er Jahre. Tarzan will also die Tiere und Landschaften kennen lernen, bevor der Urwald abgeholzt ist, die Pampas versteppt, die letzten Pferde durch Autos ersetzt und die letzten Lamas im Kochtopf gelandet sind. Mit Mühe hat er den kostspieligen Abstecher zu den Wasserfällen von Iguaçú durchgesetzt. Aber nun streikt Melone: "Wir bekommen unsere Route sowieso nicht mehr wie geplant durch; ich bleibe hier und kuriere mich aus; ich habe solche Kopfschmerzen." - "Ich fliege doch nicht nach Südamerika, um hier zwei Monate in den Anden herum zu hängen." - "Ja was denn, wir haben ein Flugticket, und solange die Mühle nicht abheben kann, zahlt die Fluggesellschaft unser Hotel und den Voucher fürs Restaurant. Da kann ich mein Geld besser anlegen." - "Warum hat mich Gott bloß so gestraft mit diesen beiden Typen?" fragt sich Lulatsch. "Melone hat angeblich Kopfschmerzen, aber er ist nicht zu krank, um jeden Tag in den Puff zu gehen; und Tarzan fährt nach Machu Picchu, aber statt mit mir den Gipfel zu erklimmen und ein paar schöne Fotos zu machen, bleibt er mitten im Ruinenfeld sitzen und flirtet mit irgendwelchen blöden Weibern herum. Sodom und Gomorrha!" Tarzan sieht das ganz anders: In den Puff würde auch er nicht gehen - schon gar nicht ohne Gummi, wie Melone das ständig tut (es gibt noch kein AIDS, jedenfalls weiß man noch nichts davon); aber die netten chilenischen Studentinnen (für die Perú ein billiges Urlaubs-Paradies ist, wie es für die Deutschen früher Italien war, inzwischen Spanien ist, und bald Griechenland und die Türkei sein werden) sind doch zwischen all den fetten, schmutzigen Indio-Weibern der bisher einzige erfreuliche Anblick auf dieser Reise.
[Erst im Rückblick wird Tarzan begreifen, daß Fett bei den Indios - anders als bei den Europäern und Nordamerikanern - kein Zeichen von ungezügelter Freßgier und mangelnder Bewegung ist, sondern von Klugheit: Die Oberschicht kann ihr Geld in Aktien oder Immobilien anlegen, die Mittelschicht in Schmuck; aber die Unterschicht wäre dumm, wenn sie ihre Ersparnisse auf die Bank trüge, wo sie die Inflation bald auffressen würde; da ist es schon besser, eine kleine Fettreserve im eigenen Körper anzulegen, denn in Notzeiten verhungern hier noch Menschen. Auch in Europa galt es vor zwei bis drei Generationen noch als Schönheitsideal, etwas mollig zu sein - aus den selben Gründen, auch wenn wir das heute gerne verdrängen.]
Außerdem haben die Chileninnen Pfirsiche in Dosen dabei; und für Tarzan gehört gut Essen und Trinken mit zu einer gelungen Reise; und da ist er bisher gar nicht auf seine Kosten gekommen: Die Indios essen bevorzugt "cuy" (geröstete oder in Lehmkruste gebackene Meerschweinchen) und "choclos" (gedämpfte oder gebratene - und dann meist angebrannte - Maiskolben) oder "cebiche" (eine bitter-scharfe Fisch-Pampe mit Haut und Gräten); dazu trinken sie "chicha" (selbst gebrautes Maisbier) und "pisco" (selbst gebrannten Fusel); und wenn von alledem etwas übrig bleibt, werfen sie es zusammen mit anderen Abfällen in einen Kessel mit heißem Wasser und kochen daraus "sopa criolla" (kreolischen Suppen-Eintopf). Die erste Lektion, die Tarzan in Perú lernt, lautet: Schöne Landschaften kann man nicht essen, alte Inka-Ruinen und spanische Kolonial-Paläste auch nicht. Steine reden nicht, oder zumindest sagen sie ihm nichts. Und die Menschen, die sie bewohnen, sprechen womöglich eine ganz andere Sprache als die, die sie erbaut haben, selbst wenn sie die gleichen Wörter benutzen. Mit den chilenischen Touristen dagegen kann sich Tarzan ausgezeichnet verständigen - die sprechen die gleiche Sprache wie er, auch wenn er sie "Spanisch" und die sie "Kastilianisch" nennen, und wenn sie die Berge, die er "Anden" nennt, "Kordilleren" nennen. [Was irgendwie paradox ist: "Andes" kommt aus der Quechua-Sprache und bedeutet "Kupferberge" - dabei wurde und wird in den Ländern, wo man dieses Wort gebraucht, relativ wenig von jenem Metall gefunden; die Hauptvorkommen liegen ausgerechnet in Chile, wo man "Cordilleras" sagt - das spanische Wort für (Berg-)Ketten.] Es kommt auf die Gemeinsamkeit der Dinge an, nicht auf die der Benennungen. Auf keinen Fall will er Chile aus seinem Reiseprogramm streichen. Nach einem mittelgroßen Krach trennen sich die drei: Melone - den die "verwestlichten" Länder im Süden Südamerikas ohnehin weniger interessieren - bleibt in Perú und betreibt dort intensive soziologische und ethnologische Studien vorwiegend an den weiblichen Angehörigen der eingeborenen Unterschicht. Lulatsch, Tarzan, Jacky und Sarah (die beiden Chileninnen) geben ihre Flugtickets zurück und fahren mit dem nächsten Lastwagen, der sich wieder auf die Straßen traut, weiter.

weiter zur Fortsetzung
heim zu Reisen durch die Vergangenheit